Was ist eigentlich „divers“? Über diese Frage hat Denis Sariyannis nicht erst im Vorfeld dieses Gesprächs nachgedacht. Mit einer Interpretation des Begriffs kann der junge Softwareentwickler wenig anfangen: „Statt in einer Stellenanzeige nach ‘männlich/weiblich/divers‘ zu suchen, sollten Unternehmen lieber nach einer diversen Expertise suchen“, sagt er. Es reiche nicht aus, Menschen mit Behinderung einzustellen, um als Arbeitgebermarke gut dazustehen oder „nur“ um diesen Menschen das Gefühl zu geben, „ein bisschen mitmachen“ zu dürfen. Wenn sie stattdessen die Gelegenheit bekämen, sich und ihre Fähigkeiten wirklich einzubringen, hätten beide Seiten gewonnen.
Denis Sariyannis ist von Geburt an blind. „Mir fehlt ein Sinn, den muss ich ersetzen. Das ist eine Lebensaufgabe – da wurde ich nicht gefragt“, sagt er. Die Selbstverständlichkeit, mit der der 33-Jährige über seine eigene Behinderung spricht, lässt vermuten, dass er mit sich und seinem Leben zufrieden ist. Einen wichtigen Anteil daran hat sein Beruf, der ihm das ermöglicht, was anderen Menschen mit Behinderung viel zu oft verwehrt bleibt: Teilhabe. „Der Beitrag, den ich leiste, muss einen Sinn ergeben, das ist für mich wie ein Lebensmotto“, sagt Sariyannis, der 1988 als Sohn einer deutschen Mutter und eines griechischen Vaters in Deutschland geboren wurde, im badischen Gaggenau aufgewachsen ist und seit fast 13 Jahren in Walldorf lebt und arbeitet.
Umfangreiche Unterstützung von SAP
Walldorf? Richtig. Der Arbeitgeber des Fachinformatikers ist das wertvollste deutsche Unternehmen, SAP. Nach seinem Abitur begann Sariyannis 2008 dort eine duale Berufsausbildung zum Fachinformatiker mit Schwerpunkt Anwendungsentwicklung. Seine Bewerbung sei er anders als manche ehemaligen Mitschüler*innen „ganz bewusst offensiv“ angegangen: „Ich habe meine Behinderung direkt angegeben, und wir haben ein normales Vorstellungsgespräch geführt, das vielleicht ein wenig länger gedauert hat.“ Mit welcher Unterstützung er seine Arbeit einfacher gestalten könnte, sei in einem offenen und pragmatischen Dialog geklärt worden. Vieles von dem, was die SAP ihm und seinen Kolleg*innen heute biete, sei nicht selbstverständlich. Dabei meint er nicht nur die Arbeitsplatzausstattung, sondern auch die Tatsache, dass ihm das gleiche Equipment seit Corona auch im Homeoffice zur Verfügung gestellt wird.
Wie ermöglicht es ein Unternehmen seinem Mitarbeiter, der durch seine Sehbehinderung deutlich eingeschränkt ist, seine Aufgaben bestmöglich zu erfüllen? Zunächst sei alles eher „unspektakulär“: „Ich komme wie viele andere Mitarbeiter mit dem Bus zur Arbeit und laufe zum Büro, wo ich mich an einen normalen Schreibtisch mit Laptop setze“, sagt Sariyannis und fügt schmunzelnd an: „Okay, dabei sehe ich nichts.“ Sein barrierefreies direktes Arbeitsumfeld sieht so aus: Auf dem Laptop ist eine Software, ein sogenannter Screenreader, der ihm jeweils die Inhalte vom Bildschirm vorliest, an denen sich der Cursor befindet. Auf einem weiteren Gerät, einer Braillezeile, kann er einzelne Bildausschnitte in Punktschrift mit seinen Fingerspitzen „lesen“.
„Das ist beim Programmieren sinnvoll, denn dabei tauchen viele Sonderzeichen auf“, sagt der Softwareentwickler. Er erstellt vor allem Logiken der Software, die im Hintergrund – im sogenannten Backend – ablaufen, weniger klassische Benutzeroberflächen wie Webseiten. Dafür schreibt er Quelltext (Source Code) in Programmiersprachen, die visuellen Anteile übernehmen seine Kolleg*innen.
„Der Screenreader und die Braillezeile sind mein Bildschirm“
Während ein sehender Mensch den kompletten Bildschirminhalt auf einen Blick erfassen kann, muss ihn sich Sariyannis in vielen kleinen Abschnitten mit anderen Sinnen – dem Hören und Tasten – erschließen: So erfühlt und erhört er die Struktur des Bildschirms Stück für Stück, bestimmt die Geschwindigkeit selbst und kann vor- und zurückspulen. Dazu sei allerdings viel „Scrollen“ gefragt, die Braillezeile hat nur 80 Zeichen; zum Vergleich: Ein Tweet hat bis zu 280 Zeichen. „Der Screenreader und die Braillezeile sind mein Bildschirm, denn das, was für andere der Monitor ist, kann ich nicht nutzen“, sagt er. Dennoch stehen sogar zwei Bildschirme auf seinem Schreibtisch, da er regelmäßig mit sehenden Kollegen an Projekten arbeitet.
Die offenen Gespräche mit seinen Teamkolleg*innen und Vorgesetzten helfen ihm im Arbeitsalltag. „Ich möchte nicht ‘der blinde Denis‘ sein, auf den alle ganz besonders eingehen müssen.“ Wenn doch Unterstützung gefragt ist, gibt er gerne aktiv den Impuls dazu. „Mir ist es wichtig, dass ich nicht irgendwie dasitze und ‘nur‘ ein bisschen mitmache. Mein Anspruch ist es, einen wirklichen Beitrag zu leisten.“ Dann beschreibt er noch, wie Inklusion von seinem Team auch in der Mittagspause gelebt wird: Anders als auf dem Weg zur Arbeit verzichtet er auf dem Weg in die Kantine meist auf seinen Blindenstock, stattdessen hakt er sich ganz selbstverständlich bei seinen Kolleg*innen unter: „Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch merken, dass sie mich mitnehmen. Inklusiv haben wir uns dabei aber nie gefühlt, eher hungrig.“
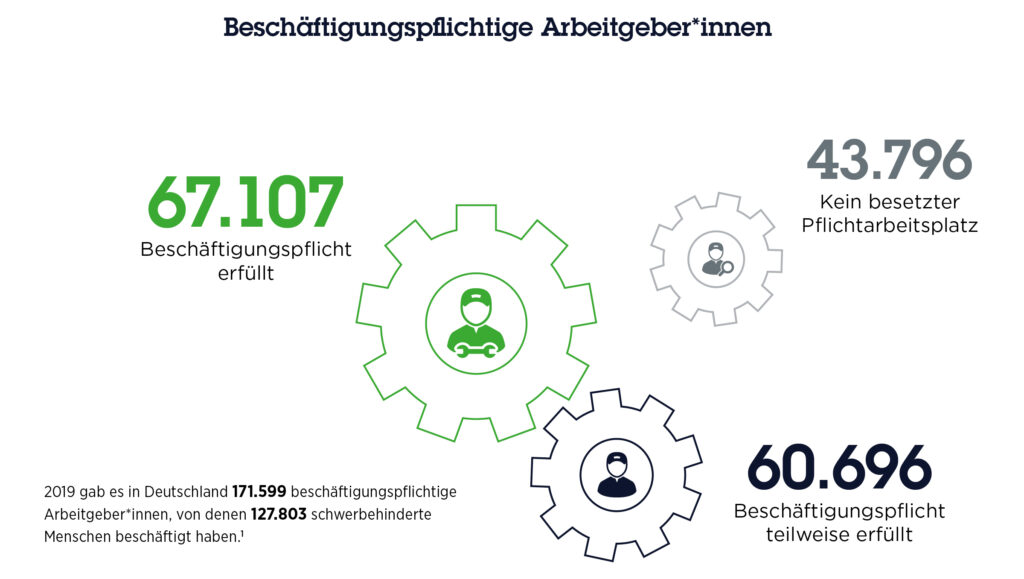
Tech-Branche macht große Fortschritte bei Inklusion und Barrierefreiheit
Gerade Unternehmen in der Tech-Branche haben in den vergangenen Jahren große Fortschritte in den Bereichen Inklusion und Barrierefreiheit erzielt. „Diese Themen waren bei den Konzernen in der Vergangenheit unter ferner liefen angesiedelt“, sagt Jens Böcker, Professor für Marketing und innovative Technologien an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Vom „Menüpunkt 15, Untermenü 28“ seien barrierefreie Funktionen mittlerweile „auf die oberste Menüleiste“ gerutscht und damit für den Nutzer sofort erkennbar. Es habe ein Paradigmenwechsel stattgefunden: Barrierefreiheit werde heute von vornherein bei der Entwicklung von Hard- und Software berücksichtigt, weil die Unternehmen erkannt hätten: „Alle Menschen – egal ob mit oder ohne Behinderung – profitieren davon, wenn die Bedienung einfacher und intuitiver ist“, so Böcker.

Gehen diese produktseitigen Entwicklungen mit einem Wandel der Unternehmenskultur einher? Magdalena Rogl, Projektleiterin Diversity/Inclusion bei Microsoft Deutschland, ist davon überzeugt. Sie ist seit sechs Jahren im Unternehmen und spricht von einem „starken Lernprozess“ in dieser Zeit. „Es gab Zeiten, in denen Microsoft als Unternehmen nicht mehr so innovativ gewesen ist. Heute gibt es ein großes Bewusstsein, dass wir Diversität und Inklusion in unserer Unternehmenskultur verankern müssen, um innovativ als Unternehmen und attraktiv als Arbeitgeber zu bleiben.“
Inklusion als Innovationstreiber bei Microsoft
Dabei sei der Weg das Ziel: „Wir müssen akzeptieren, dass es kein Prozess ist, der irgendwann abgeschlossen ist. Das Thema Inklusion entwickelt sich weiter, es kommen immer neue Aspekte dazu“, sagt Rogl und nennt als aktuelles Beispiel das Thema „Neurodiversität“: Hinter dem Begriff verbergen sich neuronale – gewissermaßen unsichtbare – Einschränkungen wie Autismus, Legasthenie oder ADHS. „Wie können wir so etwas wahrnehmen und darauf eingehen?“, fragt die Diversitätsbeauftragte. Immer vorausgesetzt, der oder die Mitarbeiter*in lasse dies auch zu. „Wir wollen schon im Bewerbungsprozess deutlich machen, dass wir auf solche Themen Rücksicht nehmen, damit die Bewerber*innen sich trauen, darüber zu sprechen.“ Diese offene Unternehmenskultur muss gelebt werden. Beschäftigte sollen sich trauen, persönliche Dinge anzusprechen – vorausgesetzt, sie wollen es –, und die Kolleg*innen sollten darauf eingehen, wenn das Gegenüber dies zulässt. Diese Idealvorstellung von „gelebter Inklusion“ verbindet Rogl mit Attributen wie Empathie, Aufmerksamkeit, Toleranz, Akzeptanz und Offenheit: „Jedes Team, das gut funktioniert, handelt inklusiv und ist inklusiv“, sagt sie. Das habe nichts damit zu tun, ob im Team Menschen mit geistiger oder körperlicher Behinderung arbeiten. Als Beispiel für diese Interpretation von „inklusiv“ nennt sie die Wertschätzung unterschiedlicher Blickwinkel und Herangehensweisen: „Inklusion bedeutet auch, dass alle Teammitglieder einbezogen werden.“
Um die „verborgenen Fachkräfte“ zu finden und ihnen ganz im Sinne von Denis Sariyannis‘ Wunsch die Gelegenheit zu geben, ihr Können unter Beweis zu stellen, arbeitet Microsoft unter anderem mit dem Wiener Start-up MyAbility zusammen. Auf deren Jobportal sollen Jobsuchende mit Behinderung und potenzielle Arbeitgeber besser zueinanderfinden, mit dem selbst erklärten Ziel, die Erwerbsquote von Menschen mit Behinderung im deutschsprachigen Raum zu steigern. „Das hilft uns im Recruiting, diese Communitys besser zu erreichen und unsere Stellenausschreibungen besser zu gestalten“, sagt Rogl. Vielleicht steht dort irgendwann auch einmal drin: „Wir suchen eine diverse Expertise.“
Dieser Artikel erschien zuerst in der März-Printausgabe der absatzwirtschaft.


